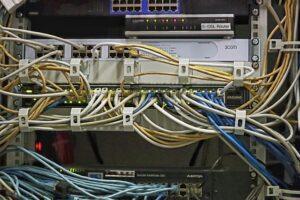Veraltete Software – so bekommt man die Risiken in den Griff.
Von Windows bis hin zu industriellen Produktionssystemen: Wie veraltete Software Unternehmen angreifbar macht und welche Strategien jetzt nötig sind.
Veraltete Software ist weit verbreitet – oft auch dort, wo man es nicht sofort vermuten würde. Beispiele für besonders langlebige Anwendungen sind das SABRE-Flugbuchungssystem oder die IRS-Systeme “Individual Master File” und “Business Master File” für Steuerdaten, die seit den frühen 1960er-Jahren im Einsatz sind. Während solche Anwendungen ihren Zweck bis heute erfüllen, existiert daneben eine Vielzahl alter Software, die längst zum Sicherheitsrisiko geworden ist.
Software, die nicht mehr unterstützt oder mit Sicherheitsupdates versorgt wird, gilt als veraltete Software. Ein prominentes Beispiel ist Microsoft Windows: Neue Versionen ersetzen ältere, die keine Updates mehr erhalten. Laut StatCounter dominieren Windows 11 und Windows 10 mit 53,3 Prozent bzw. 42,9 Prozent Marktanteil. Dennoch laufen weiterhin Windows 8 (rund 1 Prozent), Windows 7 (2 Prozent) und sogar Windows XP (0,44 Prozent). XP wurde bereits im April 2014 abgekündigt, bleibt aber vereinzelt im Einsatz. Für Windows 10 endet der Support am 14. Oktober 2025 – ein einschneidendes Ereignis für ein Betriebssystem, das auf über einer Milliarde Geräten installiert war.
Aber warum bleibt Software mit abgelaufenem Support überhaupt im Einsatz? Idealerweise würden alle Systeme auf die neuesten und sichersten Versionen umgestellt. In der Praxis aber sind manche Hersteller nicht mehr am Markt oder stellen Updates ein. Unternehmen scheuen Lizenzkosten, solange die alte Lösung funktioniert. In einigen Fällen ist ein Upgrade technisch unmöglich, weil jede Änderung etablierte Geschäftsprozesse gefährden würde. Auch überhöhte Kosten für eine Neuentwicklung oder schlicht fehlende Transparenz im Asset Management führen dazu, dass veraltete Systeme in Betrieb bleiben.
Veraltete Software managen
Unabhängig vom Einzelfall stellen diese Systeme ein Risiko dar. Der 2023 Qualys TruRisk Threat Research Report zeigt, dass fast die Hälfte (48 Prozent) der Schwachstellen auf der CISA Known Exploited Vulnerabilities List auf veraltete Software zurückzuführen sind. Rund 20 Prozent geschäftskritischer Assets enthalten Komponenten mit abgelaufenem Support, die bereits als „hoch“ oder „kritisch“ eingestuft sind.
Ein professionelles Vorgehen erfordert ein sicherheitsorientiertes Asset Management: Transparenz über vorhandene Systeme, klare Verantwortlichkeiten und die Bewertung der damit verbundenen Risiken. Klassische ITAM-Tools decken diesen Aspekt in der Regel nicht ab – für eine Priorisierung der Behebung ist er jedoch entscheidend.
Darüber hinaus ist eine konsequente Nachverfolgung des Software-Lebenszyklus erforderlich – vom Release bis zum Support-Ende. Regelmäßige Reports über Systeme, die in den kommenden sechs bis zwölf Monaten aus dem Support fallen, schaffen die Grundlage für frühzeitige Migration oder Upgrade-Planung.
Wenn Systeme aus Kostengründen nicht ersetzt werden, sollten Business Case und Budget sauber dokumentiert sein. Gleichzeitig ist der Value at Risk zu ermitteln – also der potenzielle Schaden durch Ausfälle oder Sicherheitsvorfälle. Auf dieser Basis lässt sich belegen, wann die Kosten für eine Migration geringer sind als das Risiko, bestehende Systeme weiterzubetreiben.
Besondere Herausforderungen entstehen bei Anwendungen, deren Verfügbarkeit direkt mit Umsätzen verknüpft ist. Hier stoßen Abschaltungen naturgemäß auf Widerstand – jede Downtime bedeutet unmittelbare Verluste. Dieses Festhalten birgt jedoch selbst ein erhebliches Risiko. Vergleichbare Single Points of Failure wie der Ausfall von Schlüsselpersonen (etwa im Produktdesign oder im Management) werden längst mit Policen wie “Key Person Insurance” abgesichert.
Selbst bei geschäftskritischen Systemen existieren oft Zeitfenster für Veränderungen. Ein Beispiel: Ein Hersteller lehnte Updates seiner Produktionssysteme ab, nutzte jedoch planmäßige Stillstände beim Schichtwechsel, um Änderungen schrittweise einzuspielen. Mit vorausschauender Planung lassen sich Risiken reduzieren, ohne die Produktivität zu gefährden.
Hürden überwinden
Lässt sich ein Ersatz nicht realisieren, kommen Schutzmaßnahmen ins Spiel: Air-Gapping, isolierte Netzwerke, Application Firewalls oder die Beschränkung auf vertrauenswürdige Geräte. Ebenso wichtig ist das Aufspüren potenzieller Fehlkonfigurationen und Angriffspfade, um alternative Verteidigungsstrategien umzusetzen. Solche Kompensationsmaßnahmen bilden einen zentralen Baustein einer mehrschichtigen Sicherheitsarchitektur.
Im Unternehmensalltag wird ausgelaufene Software oft als zusätzlicher Kostenfaktor betrachtet – insbesondere unter Budgetrestriktionen. Um die Relevanz im Business-Kontext zu verdeutlichen, empfiehlt es sich, Risiken in monetären Werten darzustellen. Genau diesen Ansatz verfolgen Unternehmen längst bei anderen Risikopositionen.
Hinzu kommt der mögliche Dominoeffekt: Ein Angriff auf ein scheinbar unkritisches Asset kann sich rasch ausbreiten oder als Ausgangspunkt für laterale Bewegungen dienen. Das Bewusstsein für kompromittierte Systeme ist vorhanden – konkrete Zahlen zu möglichen finanziellen Auswirkungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass das Management notwendige Maßnahmen unterstützt.
Lebenszyklus von Software beachten
Jede Software hat einen Lebenszyklus. Selbst Systeme, die jahrzehntelang zentrale Funktionen erfüllen, werden irgendwann ersetzt. Die zentrale Herausforderung liegt darin, Abhängigkeiten zu vermeiden, bei denen das Abschalten selbst als Risiko gilt. Stattdessen sollten Risiken transparent gemacht, geschäftliche Auswirkungen beziffert und frühzeitig Gegenmaßnahmen geplant werden. Mit dem Value-at-Risk-Ansatz lassen sich Argumente in geschäftsrelevante Dimensionen übersetzen und damit nachhaltige Entscheidungen jenseits rein technischer Überlegungen treffen.