Startseite » Ratgeber » IT-Sicherheitsgesetze » Überblick » Digital Services Act
Digital Services Act (DSA)
Die Verordnung (EU) 2022/2065, auch bekannt als Digital Services Act (DSA), wurde am 19. Oktober 2022 vom Europäischen Parlament und dem Rat der Europäischen Union verabschiedet. Sie stellt einen zentralen Bestandteil des europäischen digitalen Regelwerks dar und zielt auf die Schaffung eines sicheren, transparenten und vertrauenswürdigen digitalen Binnenmarkts ab. Der DSA ersetzt dabei nicht die Richtlinie 2000/31/EG (E-Commerce-Richtlinie), sondern aktualisiert und ergänzt sie, um aktuellen Herausforderungen im digitalen Raum zu begegnen.
Ziele und Motivation
Zentrales Ziel der Verordnung ist es, einheitliche Regeln für digitale Vermittlungsdienste wie soziale Netzwerke, Hosting-Plattformen oder Suchmaschinen zu schaffen, um ein hohes Maß an Verbraucherschutz und Grundrechtssicherheit im Online-Raum zu gewährleisten. Der DSA reagiert auf die gestiegene Bedeutung digitaler Dienste in Wirtschaft und Gesellschaft sowie auf die neuen Risiken, die aus der Verbreitung von rechtswidrigen Inhalten, Desinformation und der Marktbeherrschung großer Plattformen resultieren.
Anwendungsbereich und betroffene Dienste
Die Verordnung richtet sich insbesondere an sogenannte Vermittlungsdienste, die als „reine Durchleitung“ (z. B. Internetanbieter), „Caching“ (Zwischenspeicher) oder „Hosting“ (z. B. Cloud- und Webhosting, soziale Netzwerke) tätig sind. Besonders in den Fokus rücken Online-Plattformen, die Inhalte öffentlich verbreiten oder Online-Shopping ermöglichen, sowie sehr große Online-Plattformen und Suchmaschinen mit über 45 Millionen monatlichen Nutzern in der EU.
Verpflichtungen und Sorgfaltspflichten
Der DSA etabliert ein abgestuftes System von Sorgfaltspflichten, das je nach Art und Größe des Dienstes variiert:
- Alle Vermittlungsdienste müssen eine Kontaktstelle benennen, auf behördliche Anordnungen reagieren, transparente Nutzungsbedingungen bereitstellen und einen gesetzlichen Vertreter in der EU benennen, falls sie außerhalb der EU sitzen.
- Hostingdienste sind verpflichtet, ein Melde- und Abhilfeverfahren einzurichten, um rechtswidrige Inhalte schnell entfernen zu können. Sobald ein Anbieter Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten erlangt, muss er tätig werden.
- Online-Plattformen müssen ein internes Beschwerdesystem bereitstellen, systematische Risiken identifizieren, Minderjährigenschutz beachten und Transparenzberichte veröffentlichen.
- Sehr große Plattformen und Suchmaschinen haben darüber hinausgehende Pflichten wie regelmäßige Risikoanalysen, Zugang für Forscher, Transparenzpflichten in der Werbung und Überwachungspflichten durch unabhängige Prüfstellen.
Haftung und Inhalte
Die Haftungsregeln bleiben im Kern bestehen, wie sie in der E-Commerce-Richtlinie formuliert wurden: Anbieter von Durchleitung, Caching oder Hosting haften grundsätzlich nicht für fremde Inhalte, solange sie keine Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten haben oder nach Kenntniserlangung nicht handeln. Die Verordnung stellt jedoch klar, dass eine aktive Rolle – z. B. durch gezieltes Bewerben rechtswidriger Inhalte – diese Haftungsprivilegien ausschließt.
Bekämpfung rechtswidriger Inhalte
Ein zentrales Anliegen ist der Kampf gegen illegale Inhalte, darunter Hassrede, Terrorismus, Kinderpornografie oder gefälschte Produkte. Hierfür müssen Dienste effektive Mechanismen zur Meldung und Entfernung einrichten. Auch nationale Behörden können Anordnungen zur Entfernung oder zur Bereitstellung von Nutzerinformationen erlassen.
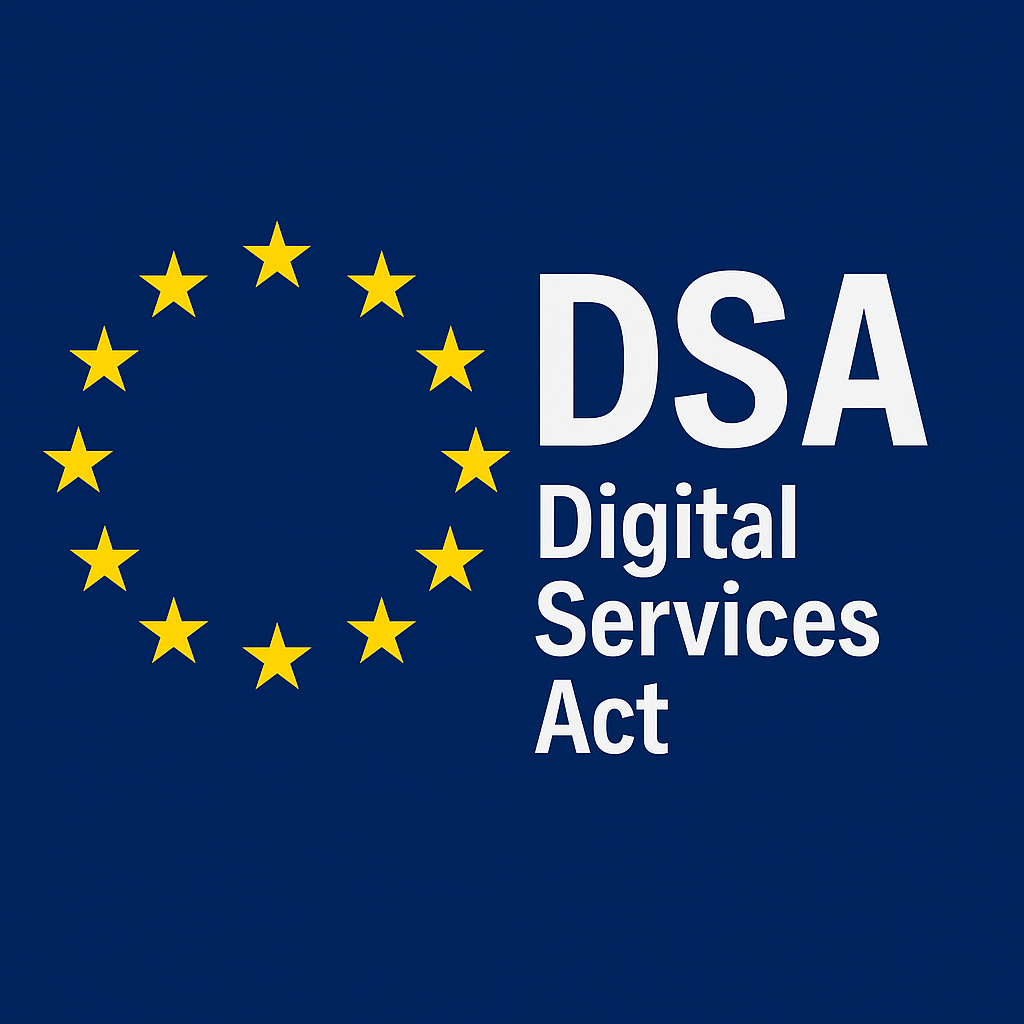
Grundrechtsschutz und Transparenz
Die Verordnung betont den Schutz der Grundrechte, insbesondere der Meinungsfreiheit, der unternehmerischen Freiheit und des Datenschutzes. Inhalte dürfen nicht willkürlich entfernt werden. Nutzer müssen über Entscheidungen informiert werden und die Möglichkeit zum Widerspruch haben. Transparenz über algorithmische Entscheidungsprozesse, insbesondere bei der Moderation von Inhalten oder personalisierter Werbung, ist verpflichtend.
Durchsetzung und Aufsicht
Zur Umsetzung wird ein Koordinator für digitale Dienste (Digital Services Coordinator, DSC) in jedem Mitgliedstaat ernannt. Die Zusammenarbeit der nationalen Behörden wird durch den Europäischen Ausschuss für digitale Dienste koordiniert. Die Europäische Kommission übernimmt die Aufsicht über sehr große Plattformen.
Fazit
Der DSA markiert einen bedeutenden Schritt in der europäischen Digitalpolitik. Er schafft ein modernes, kohärentes Regelwerk, das Fairness, Transparenz und Sicherheit im digitalen Raum fördern soll. Plattformen müssen stärker Verantwortung übernehmen, ohne dabei Innovationen und Meinungsfreiheit zu gefährden. Das Gesetz steht für einen europäischen Ansatz im Umgang mit der Macht großer Internetakteure und dem Schutz der Bürgerrechte im digitalen Raum.



